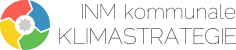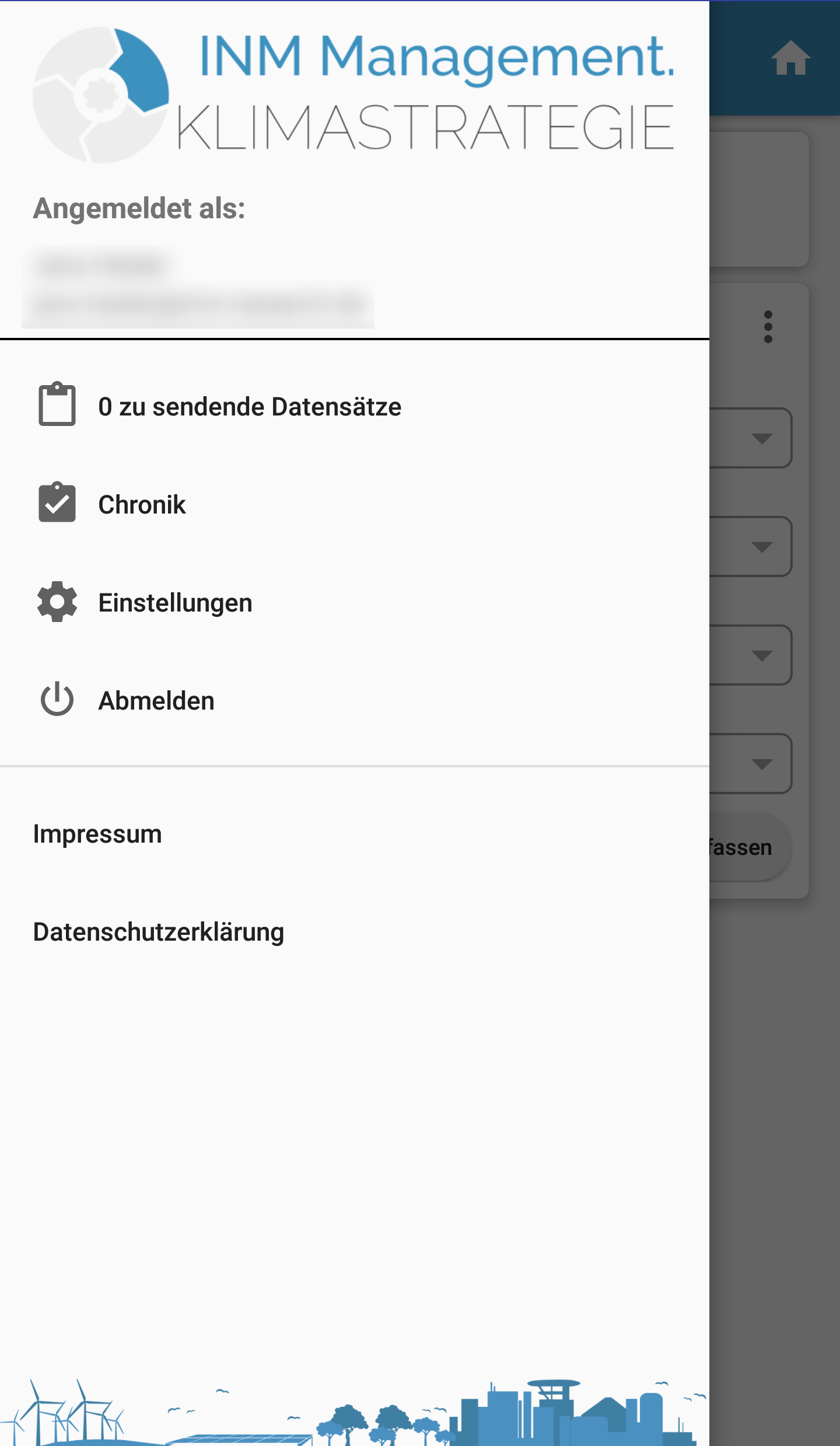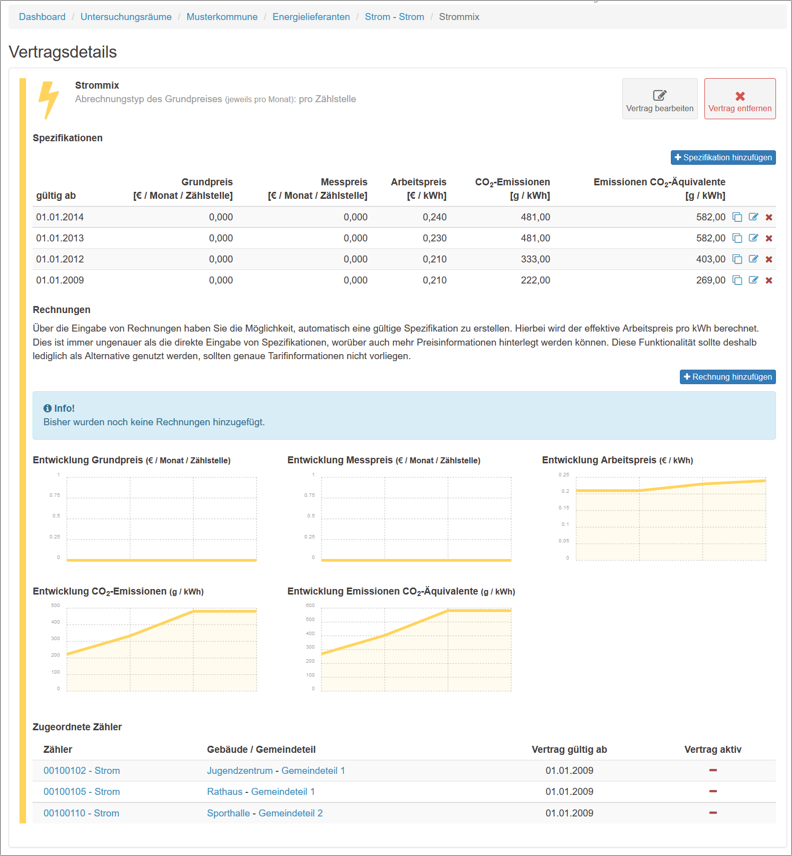Nach der Integration der INM Management Smartphone-App im vorletzten Update, freuen wir uns, Ihnen hiermit eine aktualisierte und verbesserte Version zur Verfügung stellen zu können. Wir haben uns bei der Entwicklung bemüht, die einfache Oberfläche der App zur Erfassung der Zählerstände vor Ort weiter zu verbessern, um Ihnen eine simple und intuite Nutzung zu gewährleisten.
Zusammenkommen ist ein Beginn,
Henry Ford
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg
Weihnachten steht vor der Tür und wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Neben der Entwicklung und Einführung unserer INM Management Smartphone-App, die der Vereinfachung der Zählerstandserfassung dient, sind als weitere Höhepunkte des vergangenen Jahres die vier großen Updates im Januar, März, Juli und Dezember zu nennen. Außerdem durften wir uns darüber freuen, beim Vergleich von 225 Softwaresysteme zum Energiemanagement im Auftrag der LENA, der Energieagentur Sachsen-Anhalt GmbH, an der Spitze des Rankings zu stehen. Sowohl Ihr Feedback als auch Ihre konkreten Vorschläge zur Verbesserung unserer Dienste haben einen großen Teil dazu beigetragen und sind ausschlaggebend für die stetige Weiterentwicklung unserer Systeme. Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle unseren Dank aussprechen und hoffen in diesem Sinne auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit auch im neuen Jahr.
Wie bereits im vorherigen Blogeintrag angekündigt, haben wir mit dem INM Management — Update 2017.07 unsere zugehörige Smartphone-App integriert. Diese ermöglicht es Ihnen, Zählerstände noch einfacher und vor allem direkt vor Ort zu erfassen. Somit werden Umwege wie das Eintragen in separate Listen und späteres Überführen in das System überflüssig.